Das Leben der anderen - Von hier an blind...

Es gab eine Zeit, da schien die Zukunft vertraut. Der Mensch wähnte sich am Ende des Anthropozäns und glaubte, mit ihm und der Erde würde es böse enden, und er selbst sei schuld daran.
Dennoch war er glücklich. Nicht sehr besorgt lebte er dahin in der "breiten Gegenwart", wie der Literaturhistoriker Hans Ulrich Gumbrecht das Zeitgefühl der Epoche charakterisierte. Nur aufs Jetzt konzentriert, verlernte der Mensch, so Gumbrecht, sich zu Vergangenheit und Zukunft zu verhalten. Kurz: Er war recht passiv und nahm die Zukunft, als ginge sie ihn nichts an. Manchmal konsumierte er sie sogar als apokalyptisches Klimaszenario oder Endzeitfilm. "Reflexion im Futur II" nennt die Kulturwissenschaftlerin Eva Horn diese mediale Apokalypse-Besessenheit. Indem der Mensch, so Horn, zurückschaue auf sich nach dem Verschwinden, schließe er ab mit der Zukunft, die ihm blüht. Viele Geschichten jener Zeit begännen deshalb mit einem "Es wird einmal gewesen sein" statt dem klassischen "Es war einmal".
Selbsttäuschung war die Regel. Überfluss und Reichtum suggerierten dem wohlhabenden Teil der Welt, dass es nie besser oder schlechter werden kann. Dort shoppte, aß und reiste man ohne Rücksicht auf Ressourcen. Genau das war das Problem. Der Gedanke, die Zukunft beeinflussen zu können durch Verzicht oder Selbstbeschränkung, schien zu unbequem und illusorisch, um ihn ernsthaft zu erwägen. Sicherheit und Besitzstandswahrung gingen über alles. Ergo fürchtete man die Offenheit der Zukunft mehr als Gletscherschmelze und Klimakollaps. Vom Untergang hatte man immerhin eine Vorstellung. Das alleine wirkte beruhigend.
Obwohl es nur Wochen her ist, dass diese Zeit gefühlt zu Ende ging, scheint sie Lichtjahre entfernt zu sein. Das Virus infizierte die "breite Gegenwart", drang in sie ein, ließ sie mutieren. Betrachtete die Politik vor Kurzem etwa noch die Pflege des Status quo als Hauptaufgabe (möglichst ohne die Bürger in ihrer Freiheit groß zu stören), ist sie nun genötigt, die Freiheit ihrer Bürger zu beschränken. Hat Politik früher mehr verwaltet, muss sie plötzlich herrschen. Sie hat keine Wahl. Herrschaft ist nicht nur alternativlos im Zeitalter des Virus, der Bürger verlangt sogar danach. Pflichtgefühl, Opferbereitschaft, die Lust am starken Staat – all das steht jetzt hoch im Kurs. So als mache das Virus nicht nur krank, sondern konservativ. Freuen kann das nur rechte Potentaten. Demokraten macht es alt. Sie sehen heute aus, wie wir uns fühlen – und werden auch deswegen von den Menschen wieder respektiert.
Der Zukunft ausgesetzt, kommt jeder sich nackt vor und klein. Uns mag das neu und ungewohnt erscheinen, doch die Menschen früherer Epochen kannten das Gefühl sehr gut. Sie waren abhängig von der Natur, die gütig sein konnte und brutal. Mal brachte sie Regen, Sonne, gute Ernten. Mal strafte sie mit Hunger, Sintflut, Heuschreckenschwärmen. Eigentlich glaubten wir das alles längst vorüber. Hatten wir nicht gelernt, mit Wissenschaft und Technik uns aller Fesseln zu befreien? Von wegen, mahnt das Virus. Offen war die Zukunft immer. Nur vergaß der Mensch das irgendwann und muss die Zukunft wieder auszuhalten lernen. Nur wie?
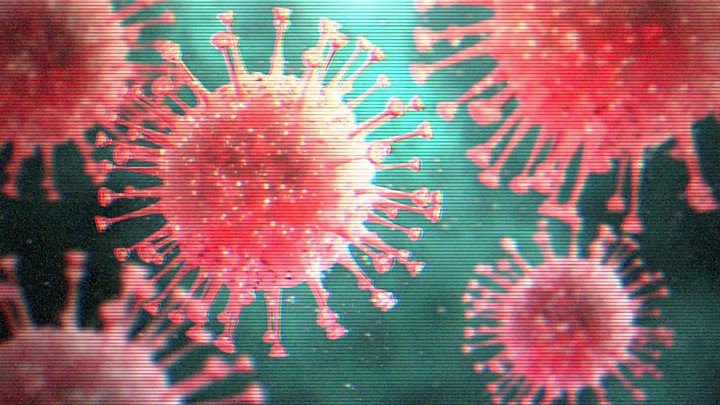 Die Ausgangslage ist alles andere als rosig. Etwas auszuhalten, was man nicht freiwillig erduldet, etwa als sportliche oder erotische Kasteiung, war als Wert nicht wichtig in der Vor-Corona-Welt. Die wenigsten waren da bereit, sich zum Wohle aller einzuschränken. Ideal war das Selbst, das alle Vorstellungen von Gott, Geschlecht und gutem Sex verwirft und sich verwirklicht. Alles, was über dieses Selbst hinausging, war verdächtig, Zwang auszuüben oder stillschweigend zu billigen. Hochverdächtig: altmodische Institutionen wie Staat, Familie oder Kirche.
Die Ausgangslage ist alles andere als rosig. Etwas auszuhalten, was man nicht freiwillig erduldet, etwa als sportliche oder erotische Kasteiung, war als Wert nicht wichtig in der Vor-Corona-Welt. Die wenigsten waren da bereit, sich zum Wohle aller einzuschränken. Ideal war das Selbst, das alle Vorstellungen von Gott, Geschlecht und gutem Sex verwirft und sich verwirklicht. Alles, was über dieses Selbst hinausging, war verdächtig, Zwang auszuüben oder stillschweigend zu billigen. Hochverdächtig: altmodische Institutionen wie Staat, Familie oder Kirche.
Je mächtiger das Ego wurde, desto mehr löste sich die Gesellschaft auf in Wünschen und Bedürfnissen. Sie zersplitterte in Identitäten und Singularitäten und drohte abzudanken als Forum für gemeinschaftliches Denken. Egozentriker kaperten die Gesellschaft und machten sie zur Bühne. Das Leben wurde, wie der Kultursoziologe Andreas Reckwitz schreibt, "im Modus der Singularisierung" nicht einfach gelebt. Es wurde "kuratiert". Das spätmoderne Subjekt "performed" dabei, "sein (dem Anspruch nach) besonderes Selbst vor den anderen, die zum Publikum werden".
Ihren politischen Ausdruck fand diese Performance in Europa ausgerechnet in Parteien, die die Parlamente zweckentfremdeten für nationalen Ausdruckstanz. Diese Parteien waren so renitent in ihrer Wirklichkeitsverleugnung, dass oft nicht auffiel, dass sie nur konservativ taten und in Wahrheit radikal zeitgeistig waren. "Du willst bleiben, wie du bist?", redeten sie dem Wähler ein. "Du darfst!" Dass sie mit der Zukunft wenig anzufangen wussten, war da nur konsequent. Wer über die Zukunft nachdenkt, leitet Ansprüche ab aus ihr fürs Jetzt. Genau das lehnten die nationalen Ausdruckstänzer aber als übergriffig ab. So wurden sie zu Mainstream-Parteien der "breiten Gegenwart" und verbreiteten Schrecken bei allen, die ahnten: Kein Status quo währt ewig.
Und so war es. Am Ende überrollte die Zukunft sie wie alle.
Die neue Welt des Virus
Heute bestimmt das Virus alle Vorstellungen vom Morgen. Wie mag sie sein, diese Zukunft, fragt sich jeder: Werde ich gesund sein, werde ich einen Job haben, werde ich auf die Straße dürfen, werde ich reisen, shoppen, Fremden die Hand geben oder nur noch Sex haben mit Mundschutz? Und was ist mit den anderen, der Familie, den Freunden, dem Staat, der Wirtschaft, der Gesellschaft? Wird die Gesellschaft das Virus überleben? Und wenn sie es überlebt, wie wird das Leben sein, wenn wir unsere Wohnungen verlassen? Wird es sein wie Ausnahmezustand, nur mit etwas mehr Klopapier im Supermarktregal?
Nichts ist mehr sicher – nicht mal, ob die neue Welt des Virus morgen noch anders sein wird als die, die gerade unterging. Skepsis ist deshalb geboten, wenn Gesundbeter und Untergangsapostel jetzt vermehrt so tun, als wüssten sie, wohin der Pfad uns führt. Sie sehen das Ende von allem oder das neue Jerusalem – dazwischen sehen sie nichts. Ihre Macht ist die Macht der Projektion.
Wenn der Zukunftsforscher Horst Opaschowski etwa glaubt, es bilde sich eine neue "Mitmach-, Zusammenhalts- und Mitbestimmungsgesellschaft" aus der in der Corona-Krise gewonnenen Einsicht, aufeinander angewiesen zu sein, ist das nur ein frommer Wunsch, aber auch rührend im Glauben an das Gute. Die "menschliche Wärme", die Opaschowski sich von der Zukunft erhofft, ist die Wärme, die er selbst vermisst (was sein Kollege Matthias Horx vermisst, wenn er sagt: In der Krise gehen "die Gehirne gewissermaßen auf", will man sich lieber nicht vorstellen).
Steht die Projektion zu ihren begrenzten Möglichkeiten, ist sie bei aller Naivität aufrichtig und ehrlich, kann sie die Zukunft in Grenzen formen nach ihrem Bild. Dafür müssten, um im Beispiel zu bleiben, nur genug Menschen wärmebedürftig sein wie der Zukunftsforscher Opaschowski. Sie müssten sich bewegen lassen von seinem Glauben an das Gute, sich reflektieren und korrigieren. Unwahrscheinlich, aber möglich.
Die Prophetie ist anders. Sie glaubt nur an sich, kennt keine Zweifel und verlangt von der Zukunft Bestätigung. Einer der modernen Propheten ist Marco Buschmann von der FDP. Kürzlich schrieb dieser einen viel beachteten Gastbeitrag für Spiegel Online. "Bald könnte Revolution in der Luft liegen", heißt es da, wenn der Ausnahmezustand anhält: Gingen Betriebe pleite und Arbeitsplätze verloren, werde die Mittelschicht sich radikalisieren. Das Bemerkenswerte an dem Text ist nicht, dass ein Liberaler hier die Revolution besingt (Verzweiflung gebiert verzweifelte Gedanken), sondern wie er die Vergangenheit benutzt für seine Prophezeiung. Weltdenker werden dafür als Kronzeugen benannt. So habe Alexis de Tocqueville etwa gelehrt, doziert Buschmann, "dass die Bürger eines Staates in Phasen langen Wohlstands immer empfindlicher gegenüber Zumutungen werden, die sie als ungerecht empfinden".
Revolutionen fänden ergo nicht statt, wenn es Leuten schlecht gehe, sondern wenn ihr Wohlstand bedroht sei. Dass Frankreichs Groß-Historiker des 19. Jahrhunderts das in Über die Demokratie in Amerika anders sah (für Tocqueville sind Bekräftigung und Beseitigung von "Ungleichheit" verantwortlich für "fast alle Revolutionen, die das Gesicht der Völker gewandelt haben"), ignoriert der gelbe Prophet. Schließlich hat sich seiner Prophezeiung jeder zu fügen, selbst der tote Tocqueville. Was soll der schon dagegen tun? Bei Markus Lanz wiederauferstehen und aus seinen Werken lesen?
In ihrer Verachtung von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft wirkt die Prophetie genau betrachtet, als könne keiner ernsthaft an sie glauben. Doch schauen manche eben nicht genauer hin, wenn ein Prophet Angst schürt vor der Zukunft. Dann gelten schlichte Lösungen als schlicht genial. Letzteres dürfte Buschmann eher nicht passieren. Sein Rezept zur Revolutionsvermeidung ist so schlicht wie fade: Die Politik müsse die Belange der Mittelschicht ernst nehmen. Das reiche schon, um den Zusammenbruch "der politisch geordneten Verhältnisse" zu verhindern.
Die Mitte ist lethargisch
Tocqueville hätte Buschmanns Revolution der Besitzenden sicher amüsiert. Mit der Mittelschicht, glaubte er, werde nie eine Revolution zu machen sein. Revolutionen verbreiten Chaos, und Chaos sei für Mittelschichtvermögen gefährlicher als Viren. Die Menschen der Mitte folgten, wie es in Über die Demokratie in Amerika heißt, deshalb selten dem politischen Propheten: "Seinem Schwung setzen sie insgeheim ihre Untätigkeit entgegen; seinen revolutionären Trieben ihr konservatives Interesse; seinen abenteuerlichen Leidenschaften ihre häuslichen Neigungen; den Ausfällen seines Genies ihren gesunden Menschenverstand; seiner Poesie ihre Prosa."
Die Mitte ist also das Gegenteil von revolutionär. Sie ist lethargisch im Naturell und konservativ in der Haltung. Nur hörte sie das vor dem Virus nicht allzu gerne. Da wollte keiner konservativ sein, nicht mal die Konservativen. Diese hielten sich oft für tolerant, weltgewandt, politisch, beruflich und religiös flexibel. Dreimal pro Woche gingen sie joggen, zweimal im Jahr flogen sie in Urlaub, einmal alle vier Jahre wählten sie Parteien, die ihrem momentanen Selbstbild entsprachen. Niemals wären sie auf die Idee gekommen, systemrelevant zu sein. Das System interessierte sie nicht sonderlich. Sie meckerten darüber, nahmen es aber meist als gegeben hin und wurschtelten sich durch ihre schönen Leben mit Job, Familie, Altbau-Apartment. Deshalb dachten sie gar nicht daran, etwas am Status quo zu ändern.
 Erst als die Pandemie kam und die Änderung alternativlos wurde, lernte die Mitte aus Angst und Antriebslosigkeit das Konservative wieder schätzen. Weil in der Mitte alle froh sind, im Ausnahmezustand keine Verantwortung zu tragen, feiern sie heute Verantwortungsträger. Weil sie selbst unfähig sind zum Heldentum, suchen sie nach Helden, die ihnen gleichen, und spenden ihnen Beifall vom Balkon. Weil sie Angst haben und viel zu verlieren, sehnen sie sich nach Hilfe von oben, dem starken Staat, und Geborgenheit in der Gemeinschaft.
Erst als die Pandemie kam und die Änderung alternativlos wurde, lernte die Mitte aus Angst und Antriebslosigkeit das Konservative wieder schätzen. Weil in der Mitte alle froh sind, im Ausnahmezustand keine Verantwortung zu tragen, feiern sie heute Verantwortungsträger. Weil sie selbst unfähig sind zum Heldentum, suchen sie nach Helden, die ihnen gleichen, und spenden ihnen Beifall vom Balkon. Weil sie Angst haben und viel zu verlieren, sehnen sie sich nach Hilfe von oben, dem starken Staat, und Geborgenheit in der Gemeinschaft.Nichts ist mehr sicher – nicht mal, ob die neue Welt des Virus morgen noch anders sein wird als die, die gefühlt gerade unterging?
Sonderlich klug, mutig oder solidarisch ist die Mitte nicht. Sie ist mittelmäßig in jeder Hinsicht. Aber sie ist zäh. Pragmatimus und Opportunismus imprägnieren sie gegen Ideologien, die im Krisenfall immer nur im Wege sind. So überstand sie alle Kriege, Krankheiten, Naturkatastrophen. Gerade weil sie Veränderungen fürchtet, meistert sie jede. Die Mitte macht keine Revolutionen. Aber überraschten die Armen oder ein paar zu allem entschlossene Revolutionäre sie damit in der Geschichte, stand eines von Beginn an fest: Die Mitte überlebt und sorgt dafür, dass es bald wieder Oben und Unten gibt. Sie ist bewunderungswürdig resilient – vorausgesetzt, sie ist sich, wie jetzt gerade, ihrer selbst bewusst und begreift sich nicht als Anhäufung von Singularitäten. Nur eines kann sie nicht: Sie kann Veränderung nicht antizipieren. Das ist wider ihre Natur.
So gab es mal eine Zeit, da schien die Zukunft allgemein bekannt. Mit der Menschheit, wusste jeder, wird es böse enden. Doch die Mitte spürte nichts davon. Sie shoppte, aß und reiste ohne Rücksicht auf Ressourcen und verwechselte das mit Fortschritt. Dieses Weiter-so ist die eigentliche Katastrophe. "Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende", wie Walter Benjamin schreibt, "sondern das jeweils Gegebene." Die "breite Gegenwart", die passiv und hilflos ist angesichts von Vergangenheit und Zukunft.
___
Quelle: Von Raoul Löbbert, 24. April 2020, 8:00 UhrAktualisiert am 26. April 2020, 10:42 Uhr; Erschienen in Christ & Welt, https://www.zeit.de/2020/18/unsicherheit-coronavirus-krise-zukunftsangst, abger. 26.04.2020 13:20 MEZ

